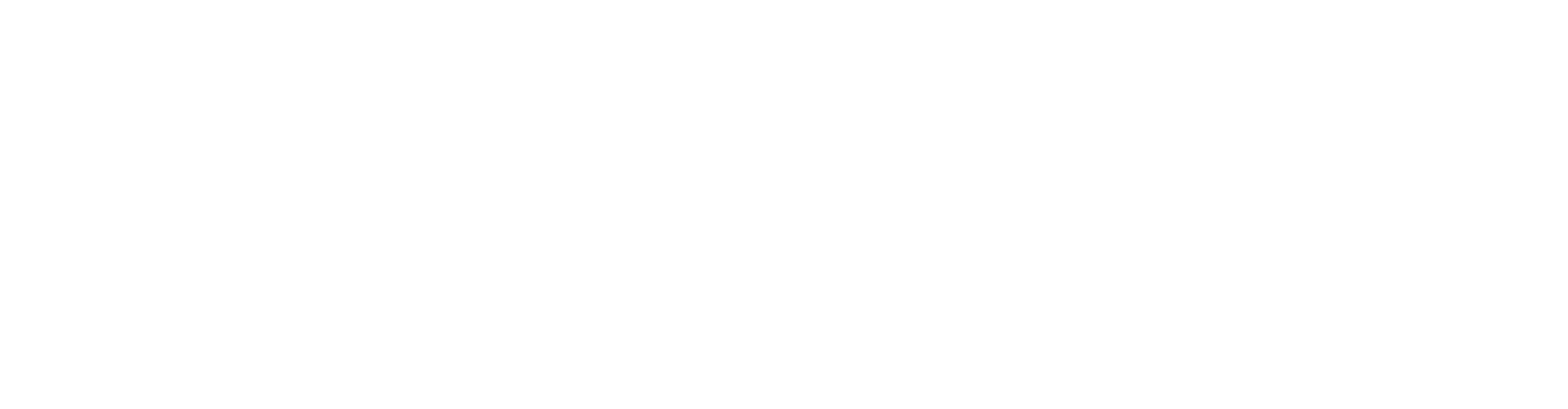Montag bis Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr

EU-Bauproduktenverordnung 2024 für mehr Klimaschutz beim Bauen
Die BauPVO 2024 ist in Kraft – ein wichtiger Inhalt ist der digitale Bauproduktenpass mit Informationen zur Nachhaltigkeit. Wichtiges Ziel dabei: eine stärkere Kreislaufwirtschaft inkl. mehr Recyclinganteile sowie eine höhere Haltbarkeit von Bauprodukten.
Parallel gibt es bei der Normen-Sammlung EU-Bauproduktenverordnung online eine Veränderung: Nach 20 Jahren übergibt Matthias Springborn die redaktionelle Betreuung an Dennis Janik. Wir haben beide zu ihrer Erfahrung mit der EU-Bauproduktenverordnung und der Überarbeitung der letzten Jahre befragt.
"Die Grundideen der Verordnung sind beibehalten worden"
| Matthias Springborn, Referatsleiter beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) ist außerdem Vorsitzender des Technischen Ausschusses bei der EOTA (European Organisation for Technical Assessment). |
-
Der Übergang von der Bauproduktenrichtlinie zur Bauproduktenverordnung war ein vergleichsweise großer Schritt. Erstens gab es nun für die Mitgliedstaaten weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit, den Inhalt des europäischen Texts gemäß den nationalen Rechtstraditionen im eigenen nationalen Recht auszugestalten, wie dies bei einer Richtlinie der Fall ist. Gravierender aber war die Aufgabe des „fitness for use“-Ansatzes, der in der Verordnung durch einen reinen Leistungsansatz ersetzt worden ist. Der Begriff der Brauchbarkeit entfiel; stattdessen regeln die harmonisierten Spezifikationen Bewertungsverfahren, die zur Ermittlung von Produktleistungen herangezogen werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Leistungen gut oder schlecht sind; die Verlässlichkeit der Information – verbunden mit der Kenntnis über die Verfahren, auf denen die Angaben basieren – steht im Vordergrund.
Für EOTA und die früheren Technischen Zulassungsstellen bedeutete das einen erheblichen Einschnitt, da das Zulassungs- durch das Bewertungskonzept ersetzt wurde. Die Europäischen Technischen Bewertungen haben – anders als früher die europäischen technischen Zulassungen – seither nur die Aufgabe, über die Produktleistungen zu informieren, unabhängig übrigens davon, ob diese gut oder schlecht sind.
Ähnlichen Übergangsschwierigkeiten sah sich auch CEN gegenüber. Wenn man heute in eine der vielen harmonisierten Normen schaut, von denen die meisten noch ein Ausgabedatum aus der Zeit der Bauproduktenrichtlinie haben, dann stößt man häufig auf Anforderungen und nicht immer auf Bewertungsverfahren, was nicht dem Konzept der Bauproduktenverordnung entspricht.
-
Mehrere Gründe dürften eine Rolle gespielt haben. Die Kommissionsdienste waren nicht zufrieden mit dem Fortschritt in der harmonisierten Normung. Wie bereits erwähnt, gab es im Zusammenhang mit der Umstellung von der Bauproduktenrichtlinie auf die Bauproduktenverordnung einen Konzeptionswechsel. Hinzu kam das „James-Elliott“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, da es harmonisierte Normen als Bestandteil des europäischen Rechts definierte – was die Kommissionsdienste dann übrigens auch auf Europäische Bewertungsdokumente übertragen haben. Sowohl der Konzeptwechsel als auch die neuen formalen Anforderungen an diese Normen führten dazu, dass kaum noch Normen von den Kommissionsdiensten als geeignet für die Harmonisierung und damit für die Bekanntmachung im Amtsblatt der EU angesehen worden sind. Obwohl natürlich viele harmonisierte Normen weiterentwickelt worden sind, gab es in der Folge kaum noch Bekanntmachungen von neuen harmonisierten Normen oder Normenausgaben im Amtsblatt der EU, was die immer größer werdende Lücke zwischen dem in aktuellen Normfassungen abgebildeten Stand der Technik und dem formal zu berücksichtigenden Normenbestand erklärt.
Ähnliche Probleme, wenn auch nicht ganz so gravierend, gab es bei EOTA. Wie bei Normen auch, erwarten die Kommissionsdienste die Berücksichtigung des leistungsbasierten Konzepts der Bauproduktenverordnung. Die Europäischen Bewertungsdokumente werden vor ihrer Bekanntmachung u.A. bis auf die Interpunktion und die Verwendung bestimmter Begriffe geprüft, die verboten oder auch im Gegenteil verbindlich zu verwenden sind. Diese detaillierte Prüfung, für die bei den Kommissionsdiensten keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung standen, hat dann bis Sommer 2022 zu einem erheblichen Rückstand von fast 140 Bewertungsdokumenten geführt. Dieser Rückstand konnte jedoch – nach Beschwerden von Herstellern – in einer gemeinsamen Anstrengung von EOTA und Kommissionsdiensten innerhalb von anderthalb Jahren fast vollständig abgebaut werden.
Die Kommissionsdienste haben sich daher, sozusagen als Rückversicherung, die Möglichkeit in den neuen Verordnungsentwurf geschrieben, dass sie selbst harmonisierte Spezifikationen erarbeiten können. Das ändert aber nichts am grundlegenden Problem, dass nämlich Verfasser von technischen Spezifikationen, also Techniker, eigentlich keine Rechtstexte schreiben wollen.
Schließlich dürften dann aber auch politische Erwägungen dazu geführt haben, dass nicht nur die bestehende Verordnung überarbeitet wurde – wie von den meisten interessierten Kreisen gewünscht -, sondern dass die Verordnung völlig neu aufgesetzt wurde. Dabei sollten aber Grundprinzipien beibehalten werden. Ergänzt werden nun vor allem Aspekte der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes.
-
Wie gesagt, die Grundideen der jetzigen Verordnung sind beibehalten worden. Sie wurden aber ergänzt um neue Aspekte.
Neben das rein leistungsbasierte Konzept der aktuellen Bauproduktenverordnung tritt nun zusätzlich das in anderen Harmonisierungssektoren bekannte Konzept der Konformität. Dabei geht es um die Konformität mit in bestimmten Normen vorgegebenen Anforderungen an Bauprodukte. Die Leistungserklärung wird daher in Zukunft kombiniert werden mit einer Konformitätserklärung.
Nach einer kurzen Übergangszeit von einem Jahr werden klimarelevante Merkmale verbindlich in Leistungserklärungen zu berücksichtigen sein. Für diese Merkmale wird also die Option „keine Leistung festgestellt“ nicht möglich sein. Weitere nachhaltigkeitsrelevante Merkmale folgen dann 4 Jahre später.
Für Hersteller, die den Weg zur CE-Kennzeichnung über eine Europäische Technische Bewertung gehen, gibt es auch eine wesentliche Neuerung: Eine ETA kann erst dann ausgestellt werden, wenn das zugrundeliegende Bewertungsdokument im Amtsblatt der EU bekannt gemacht worden ist.
Der Umfang der neuen Verordnung wird etwa bei dem Zweieinhalbfachen der aktuellen Verordnung liegen. Hinzu werden viele begleitende Rechtsakte kommen zu Stufen und Klassen, AVS-Verfahren (Bewertungs- und Überprüfungssysteme; im heutigen, abgekürzten Sprachgebrauch „AVCP-Verfahren“), Anforderungen an Bauprodukte etc. Alle Beteiligten werden sich erhöhten Anforderungen gegenübersehen, was sowohl den technischen Inhalt aller Verfahren und resultierenden Dokumente betrifft als auch den formalen Rahmen. In der Folge werden dann aber hoffentlich auch Nachhaltigkeitsaspekte und Klimaschutz angemessen berücksichtigt, da der Bausektor hier eine ganz bedeutende Rolle spielt.
"Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft stellen eine der zentralen Neuerungen der EU-Bauproduktenverordnung dar"
| Dennis Janik ist Referent im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Er beschäftigt sich mit Bauordnungsrecht, Vergabe- und Vertragsrecht, Bauproduktenrecht und Normung. |
-
Im Juni 2021 begann ich als juristischer Referent im heutigen Bundesbauministerium im für die EU-Bauproduktenverordnung zuständigen Referat (heute BII1). Damals wurde die Revision schon erwartet, der genaue Termin stand aber noch nicht fest. Ende März 2022 war es dann so weit und die EU-Kommission veröffentliche ihren Vorschlag für eine neue EU-Bauproduktenverordnung. Von Tag eins an war es meine Aufgabe im Referat, die Federführung für dieses Dossier innerhalb der Bundesregierung auszuüben und damit die Koordinierung zwischen den Bundesressorts und den Ländern zu leiten.
Da es sich um einen grundlegend neuen Entwurf der Verordnung mit teilweise bekannten, teilweise aber neuen Regelungen und Anforderungen handelte, stand zuerst im Vordergrund, diesen Vorschlag zu verstehen und dann zu bewerten. Als Vertreter der deutschen Delegation in der Ratsarbeitsgruppe in Brüssel konnte ich Fragen und Antworten hierzu aus erster Hand erhalten, was meinem eigenen Verständnis für die immer noch neue Thematik sehr förderlich war.
In zahlreichen Stellungnahmen haben wir als deutsche Delegation Einfluss auf die Entwicklung der Ratsposition nehmen können. Die interne Abstimmung war dabei nicht immer einfach, da die verschiedenen Bundesministerien aber auch die Länder teilweise unterschiedliche Interessen verfolgen. Innerhalb der Ratsarbeitsgruppe, also zwischen den Mitgliedstaaten herrschte stets eine sehr gute und konstruktive Arbeitsatmosphäre. Die Meinungsverschiedenheiten waren oft nur gering, sodass wir mit der Arbeit an der Ratsposition gut vorankamen. Lediglich in den Trilog-Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament mussten wir einige Kompromisse eingehen, die uns nicht so gut gefallen haben. Insgesamt ist aber ein gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsentwurf deutlich verbesserter Verordnungstext entstanden.
-
Es wird eine ganze Reihe von Neuerungen geben, allerdings nicht sofort nach Inkrafttreten der neuen Verordnung und auch nicht direkt für alle Produktgruppen, die unter die EU-Bauproduktenverordnung fallen. Wesentliche Ziele der Kommission bei der Erarbeitung der neuen Verordnung waren die Adressierung von Themen des Green Deals und des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft sowie die Berücksichtigung grundsätzlicher Digitalisierungsaspekte. Von daher werden vor allem auf die Hersteller von Bauprodukten neue Pflichten zukommen, um diese Ziele zu erfüllen. Dies kann sich dann z.B. darin abbilden, dass bestimmte Vorgaben zum Produktdesign einzuhalten sind oder auch, dass der Hersteller künftig einen digitalen Produktpass ausstellen muss, der die wesentlichen Informationen zum Bauprodukt online abrufbar macht.
Dies geschieht aber wie gesagt nur schrittweise und ist an die Überarbeitung der europäisch harmonisierten Bauproduktnormen geknüpft. Im so genannten CPR Acquis Prozess werden die Normen produktgruppenweise überarbeitet und auf die Regelungen der neuen Verordnung umgestellt. Bis dies jeweils erfolgt ist, gelten die bisher veröffentlichten Normen fort und damit auch die daraus entstehenden Anforderungen.
-
Die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft stellen eine der zentralen Neuerungen der EU-Bauproduktenverordnung dar. Dies zeigt sich z.B. darin, dass künftig die Umweltindikatoren aus der EN 15804, die bisher als Grundlage zur Ausstellung freiwilliger Umweltproduktdeklarationen (EPD`s) dienten, von allen Herstellern verpflichtend in ihrer Leistungserklärung angegeben werden müssen. Zudem wird die Kommission über delegierte Rechtsakte die Möglichkeit erhalten, Umweltanforderungen festzulegen, die dann ebenfalls verpflichtend zu erbringen sind. Dies können beispielsweise Anforderungen an die Rezyklierbarkeit, den Energieverbrauch, die Nachrüstbarkeit oder die nachhaltige Rohstoffbeschaffung sein. Wie und wovon die Kommission dann im konkreten Fall von dieser Ermächtigung gebraucht macht, werden wir nach Veröffentlichung der ersten Produktnormen unter der neuen EU-Bauproduktenverordnung sehen. Ein weiterer interessanter Aspekt könnte auch die Thematik der gebrauchten Bauprodukte werden. Diese fallen nunmehr in den Anwendungsbereich der Verordnung, wodurch es ermöglicht wird, in Zukunft auch für diese Produkte europäisch harmonisierte Normen zu entwickeln, um deren Vermarktung im EU-Binnenmarkt zu fördern.